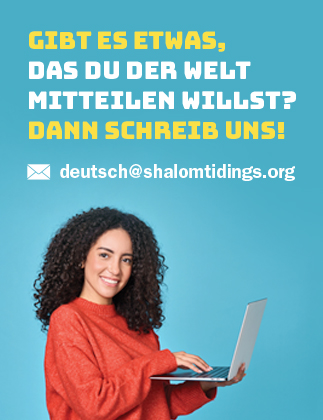Aktuell Artikel
Rüstet euch, ihr Helden des Alltags!
In einer Zeit, in der die Welt sich mit Themen wie Säkularisierung, Individualismus, Genderismus, linker Ideologie und einer überbordenden Wokeness herumschlägt, ruft uns der Epheserbrief zu einer spirituellen „Modenschau“ auf, die selbst den kühnsten Laufstegen dieser Welt die Show stiehlt. Paulus, der erste Modeschöpfer des Glaubens, präsentiert uns in Epheser 6:11-17 eine Kollektion, die mehr als nur saisonal ist: die Waffenrüstung Gottes.
Stellen wir uns vor, wie absurd es auf den ersten Blick erscheinen mag, sich mit Gürtel, Brustpanzer, Schuhen, Schild, Helm und Schwert zu rüsten, während um uns herum die Debatten über Gendersternchen und das neueste iPhone-Modell toben. Doch hier liegt der Clou: Während die Welt sich in den neuesten Trends verliert, lädt Paulus uns ein, auf das Ewige zu setzen – auf eine Mode, die niemals aus der Mode kommt.
Der Gürtel der Wahrheit? In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten ein echter Hingucker, der uns daran erinnert, dass es noch so etwas wie absolute Wahrheiten gibt, auch wenn diese in den sozialen Medien manchmal schwer zu finden sind. „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, sagt Jesus in Johannes 14:6 – ein essentielles Fundament, so grundlegend wie die Unterwäsche in unserer geistlichen Garderobe, die immer dabei sein muss.
Der Brustpanzer der Gerechtigkeit bietet perfekten Schutz gegen die spitzen Pfeile der Selbstgerechtigkeit und des moralischen Relativismus. In einer Welt, in der jeder sein eigener Richter sein möchte, erinnert uns dieser Panzer daran, dass wahre Gerechtigkeit nur von Gott kommt.
Die Schuhe der Bereitschaft, ausgerüstet mit dem Evangelium des Friedens, bieten uns festen Stand auf dem unebenen Terrain der heutigen Diskurslandschaft. Sie erinnern uns daran, dass der wahre Friede nicht in politischen Ideologien oder gesellschaftlichen Utopien zu finden ist, sondern im Evangelium Jesu Christi.
Der Schild des Glaubens ist unsere Antwort auf die flammenden Pfeile des Zynismus und der Skepsis, die so typisch für unsere Zeit sind. In einer Epoche, in der Glaube oft belächelt wird, bietet dieser Schild einen notwendigen Schutz und eine Erinnerung daran, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst.
Der Helm des Heils bewahrt unseren Geist und unsere Gedanken, indem er uns an unsere Erlösung und die zukünftige Hoffnung in Christus erinnert. Er bietet uns eine Perspektive der ewigen Hoffnung und des Sieges, selbst in den düstersten Zeiten.
Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ist wie ein göttliches Schweizer Messer: Kompakt, multifunktional, aber mächtig, um die List des Bösen zu durchkreuzen. Es bietet uns die nötige Schärfe und Licht in dunklen Zeiten.
Paulus‘ Einladung, die Rüstung Gottes anzuziehen, ist mehr als spirituelle Routine; sie ist eine augenzwinkernde Aufforderung, gegen den Strom zu schwimmen. In einer Zeit, in der das Absurde oft zur neuen Normalität wird, erinnert uns die Waffenrüstung Gottes daran, dass wir gerufen sind, anders zu sein – nicht als modische Rebellen, sondern als Zeugen einer ewigen Wahrheit, die die Zeiten überdauert. Lasst uns also mutig diese göttliche „Mode“ anlegen und in einer Welt voller Vergänglichkeit ein Zeichen der Hoffnung setzen.
Don Philipp Isenegger ist Priester in der Schweiz und Geistlicher Leiter vom BLESS Missionswerk.
Neueste Artikel
Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben?
Erhalten Sie die neuesten Informationen von Tidings!